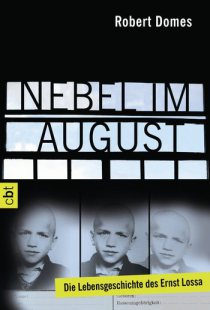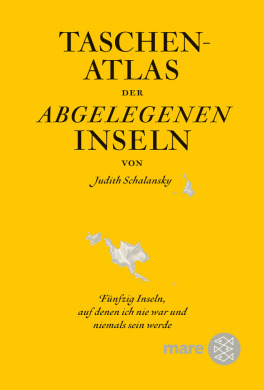„Nach meiner Auffassung stoße ich, wenn ich mich mit der traumatischen Wirkung von Auschwitz auseinandersetze, auf die Grundfragen der Lebensfähigkeit und kreativen Kraft des heutigen Menschen: das heißt, über Auschwitz nachdenkend, denke ich paradoxerweise vielleicht eher über die Zukunft nach als über die Vergangenheit.“
Imre Kertész, Rede zur Verleihung des Nobelpreises für Literatur, 2002
Vorangestellt dem Buch „Was hat der Holocaust mit mir zu tun?“, Herausgeber Harald Roth
1998:
Friedenspreisrede von Martin Walser in der Frankfurter Paulskirche. Ein Zitat:
„Kein ernstzunehmender Mensch leugnet Auschwitz; kein noch zurechnungsfähiger Mensch deutelt an der Grauenhaftigkeit von Auschwitz herum; wenn mir aber jeden Tag in den Medien diese Vergangenheit vorgehalten wird, merke ich, dass sich in mir etwas gegen die Dauerpräsentation unserer Schande wehrt.“
Weiter sträubt es sich in mir, aus dieser Rede zu zitieren – Walser verdreht gar die Formulierung von Hannah Arendt um in eine „Banalität des Guten“, diskreditiert damit sowohl den Ansatz Hannah Arendts als auch die Anstrengungen vieler, einen Teil zur Erinnerungsarbeit beitragen zu wollen, die eine Wiederholung verhütet. Vor allem aber predigt er einer „politikfreien“ (moralfreien?) Literatur das Wort.
(Ein kluges Essay zur Walser-Rede findet sich hier: Erinnern oder Vergessen? http://www.hagalil.com/antisemitismus/deutschland/walser-1.htm)
Doch der Dichter sprach dem Volk wohl aus der Seele:
„Ferner stimmen 61 Prozent (1998: 63 Prozent) der Auffassung zu, dass 58 Jahre nach Kriegsende nicht mehr so viel über die Judenverfolgung geredet, sondern endlich ein Schlussstrich unter die Vergangenheit gezogen worden sollte.“
(Forsa-Studie)
2003:
„Jeder fünfte Deutsche ist latent antisemitisch. Dies war das erschreckende Ergebnis einer Forsa-Studie im Auftrag des stern im November 2003. Befragt wurden 1.301 Bundesbürger. Bereits 1998 wurde die Studie mit den gleichen Fragestellungen schon einmal durchgeführt, so dass sich Veränderungen über die Einstellung der Deutschen zu den Juden ablesen lassen. Demnach ist der Anteil der Deutschen mit “latent antisemitischen” Einstellungen von 20 auf 23 Prozent gestiegen. Die Befragten konnten bei ihren Antworten aus einer siebenstufigen Skala auswählen von “trifft überhaupt nicht zu” (Skalenwert 1) bis “trifft voll zu” (Skalenwert 7). Wer Skalenwerte von 5 bis 7 angekreuzt hat, wird als “latent antisemitisch” eingestuft. Auf die bewusst provokant gestellte Frage, ob viele Juden versuchten, aus der Vergangenheit des Nationalsozialismus ihren Vorteil zu ziehen und die Deutschen dafür zahlen zu lassen, antworteten sogar 36 Prozent der Befragten insgesamt mit ja (1998: 41 Prozent), 89 Prozent der Befragten mit antisemitischen Einstellungen waren dieser Meinung. Und 28 Prozent insgesamt glauben, dass Juden auf der Welt zu viel Einfluss haben (1998: 21 Prozent), 81 Prozent der Gruppe mit einer ausgeprägten antisemitischen Haltung stimmten dem zu. 1998 war der Anteil derer, die eine positive Entwicklung bei den Einstellungen gegenüber den Juden zu sehen glaubten, mit 49 Prozent deutlich größer als 2003 (36 Prozent). Heute glauben 30 Prozent, die Einstellung zu den Juden sei negativer geworden (1998: 15 Prozent) Wie aus der Studie weiter hervorgeht, meinen 16 Prozent aller Bundesbürger, die Juden hätten in der Vergangenheit nicht mehr durchgemacht als andere auch.
Quelle: http://www.lpb-bw.de/auschwitz.html
2013:
In der ARD läuft – natürlich zu später Stunde – zum 75. Gedenktag anlässlich der „Reichspogromnacht“ ein Beitrag, der die Frage stellt: „Antisemitismus heute – wie judenfeindlich ist Deutschland?“.
Zwei Seiten – Verdrängung und Wiederholung. Die Haltung, >man könne es nicht mehr hören<, und steigender Antisemitismus gehen Hand in Hand.
Es ist also nach wie vor notwendig, vielleicht sogar notwendiger denn je, die Frage zu stellen: „Was hat der Holocaust mit mir zu tun?“. Herausgeber Harald Roth hat dies seinem Sammelband als Titel vorangestellt und 37 Antworten (oder besser: Versuche von Antworten und Annäherungen an diese Frage) zusammengefasst. Es schreiben Holocaust-Überlebende, Schriftsteller, Politiker, Historiker, Journalisten.
Auch Roth geht in seinem Vorwort auf die Walser-Rede ein. Und stellt sie dorthin, wo sie hingehört, weist sie zurück. „Empirisch wäre zu überprüfen, ob man überhaupt von einer >Dauerpräsentation unserer Schande< sprechen kann. Walser kann man zudem entgegenhalten, dass es in einer freien Gesellschaft eine mediale Selbstbestimmung gibt: Keiner muss sich das Buch kaufen, keiner muss sich die Sendung anschauen.“
Aber: „Die Kritiker, die über ein mediales Überangebot räsonieren, übersehen meist einen simplen Sachverhalt: Für die junge Generation ist es immer eine Erstbegegnung. Zum ersten Mal erfahren sie etwas über Auschwitz, zum ersten Mal sehen sie einen Film über die >Weiße Rose<, zum ersten Mal besuchen sie eine KZ-Gedenkstätte.“
Am 27. Januar ist, in Erinnerung an die Befreiung von Ausschwitz durch die Rote Armee, der Gedenktag zur Erinnerung an die Opfer des Holocaust: In der Bundesrepublik erst (!) 1996 eingeführt, seit 2005 ebenfalls von den Vereinten Nationen. Roth weißt zurecht darauf hin, dass die Geste des Erinnerns emotional und moralisch gefüttert sein muss. Allerdings: „Die authentischen Stimmen der Zeitzeugen“ werden in absehbarer Zeit verstummen – sie jedoch „bilden für die Nachgeborenen eine emotionale Brücke zwischen dem Gestern und Heute.“
Und so sind die Stimmen der Zeitzeugen auch mit die eindrucksvollsten Berichte in diesem Buch:
Otto Dov Kulka, der von seiner späten Wiederkehr an den Ort berichtet, den er „Landschaften der Metropole des Todes“ nennt – dieses Buch ist hier besprochen: http://saetzeundschaetze.com/2013/11/10/otto-dov-kulka-aharon-appelfeld-ringen-um-die-sprache-ringen-um-die-erinnerung/
Inge Deutschkron, die von der „Schuld der Überlebenden“ spricht und der „Pflicht, die mir meine Schuld auferlegte: Ich musste es niederschreiben Die Wahrheit, die lückenlose Wahrheit, präzise und emotionslos, so wie ich es mit eigenen Augen gesehen hatte. (…) Ich aber war wie besessen von der Idee, dass Vergleichbares nie wieder geschehen dürfe.“
Max Mannheimer, der die Lager überlebt hat, der sich niederließ im Land der Täter und auch im hohen Alter noch über das Studienzentrum in Dachau den Kontakt zu jungen Menschen sucht, um aufzuklären. Er schreibt: „Trotz der bitteren Erkenntnis, wozu Menschen fähig sind, wollte ich nicht, dass der Holocaust mich davon abhielt, an das Gute zu glauben, an die Hoffnung, an das Leben.“ Er appelliert an die Jugend: „Vergesst nicht, was geschehen ist, und entwickelt daraus Maßstäbe für euer eigenes Handeln.“
Edward Kossoy, der als Anwalt das unwürdige Feilschen um die Wiedergutmachungsleistungen erlebte: „Immer blieb es bei 150 Mark.“
Aber auch die Stimmen aus anderen Generationen (das merkwürdige Kanzlerwort von der „Gnade der späten Geburt“) kommen zu Wort – Literaturnobelpreisträgerin Herta Müller, die eindringlich nahebringt, was es heißt, auf der Flucht und im Exil zu sein. Lena Gorelik, deren Fragen darum kreisen, warum das Jüdischsein in Deutschland keine Selbstverständlichkeit ist, sondern immer und stets mit Klärungsbedarf (Erklärungsnot?) verbunden ist. Martina Salzmann erzählt von ihrer „Muttersprache Mameloschn“.
Viele Beiträge kreisen um die Fragen, wie es möglich war, einen Massenmord in Gang zu setzen, wie es möglich war, mitzumachen und wegzusehen, warum die Ausgrenzung und systematische Ermordung einiger Bevölkerungsgruppen in einer scheinbar zivilisierten Gesellschaft stattfinden konnte. Der Politikwissenschaftler Wolfgang Seibel: „Was Hannah Arendt am Beispiel Adolf Eichmanns deutlich zu machen versuchte, war dies: Gerade dadurch, dass man kein Monster sein musste, um an der Judenverfolgung mitzuwirken, konnte sich, was als Stigmatisierung und Diskriminierung begann, in ein monströses Massenverbrechen steigern. (…) Wenn man sich an den Gedanken gewöhnt, dass sich Massenverbrechen nicht als solche ankündigen, sondern erst durch die Mitwirkung normaler Menschen mit banalen Motiven zu Massenverbrechen werden, versteht man besser, wie sie entfesselt werden und was ihre Vernichtungsdynamik tatsächlich ausmacht.“
Mit diesem Rückgriff auf die „Banalität des Bösen“ beantwortet sich auch die Frage: „Was hat der Holocaust mit mir zu tun?“. Harald Roth will mit seinem Buch junge Menschen erreichen – die Beiträge, die von Augenzeugenberichten über Portraits bis hin zu Fachbeiträgen über einzelne Aspekte (Euthanasie, Wiedergutmachung, Umgang mit Erinnerungsorten, Friedensarbeit) reichen, eignen sich gut als Einstieg und Diskussionsgrundlage. Zu hoffen ist, dass es auch jene erreicht, die die Haltung übernommen haben, „es sei jetzt genug“.
Denn:
„Das Höchste, was man erreichen kann, ist zu wissen und auszuhalten, dass es so und nicht anders gewesen ist, und dann zu sehen, was sich daraus – für heute – ergibt.“
Hannah Arendt
Zum Herausgeber: Harald Roth, geboren 1950 in Böblingen, unterrichtete bis 2012 an einer Realschule Deutsch, Geschichte und Politische Bildung. Er veröffentlichte Anthologien und didaktische Materialien zur NS-Zeit u.a. eine Auswahl für junge Leser aus Victor Klemperers Tagebuch 1933-45. Roth ist Mitinitiator der KZ-Gedenkstätte Hailfingen/Tailfingen und lebt in Herrenberg.