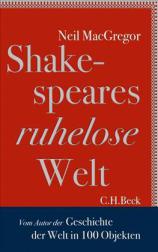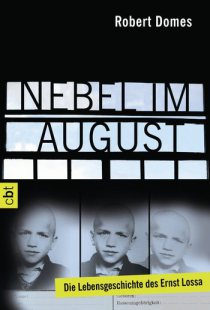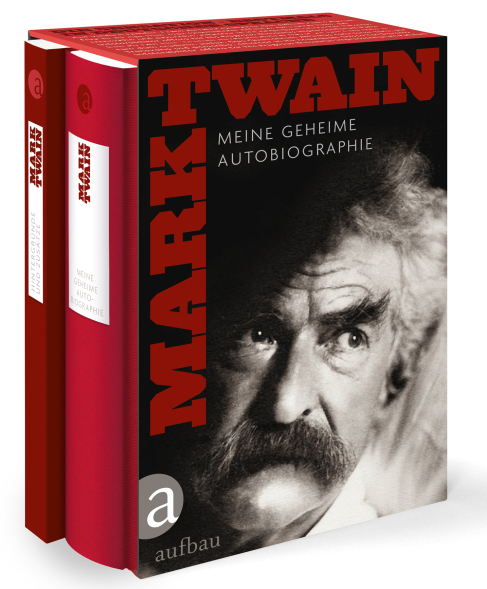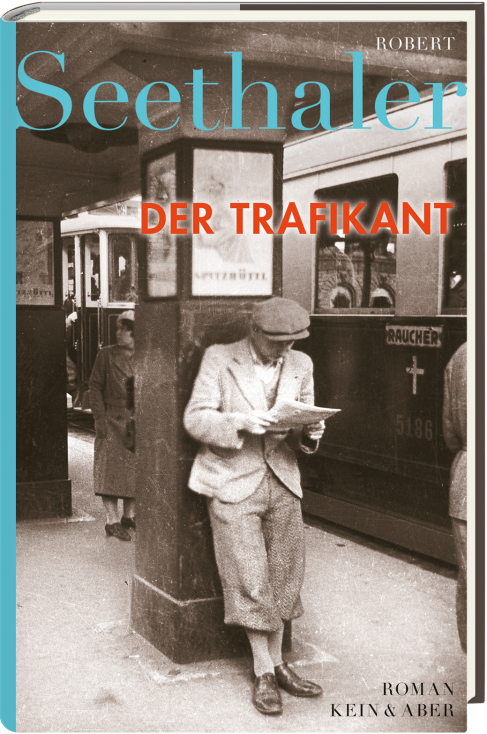Und die Geschichte ist auch nicht
der zerstörerische Bulldozer wie behauptet wird.
Sie hinterlässt Unterführungen, Grüfte, Löcher
und Verstecke. Manche überleben.
Aus: „Die Geschichte, II.“ von Eugenio Montale
Das Gedicht des italienischen Nobelpreisträgers für Literatur ist in voller Länge und in der deutschen Übertragung durch Michael von Killisch-Horn dieser Anthologie vorangestellt:
„Niemals eine Atempause“, Handbuch der politischen Poesie im 20. Jahrhundert, herausgegeben von Joachim Sartorius, 1. Auflage 2014, Verlag Kiepenheuer & Witsch.
60 Jahre Grundgesetz, 50 Jahre Vertrag von Rom, 25 Jahre Mauerfall – die Jubiläen der vergangenen Jahre waren stets begleitet vom Hinweis, dass Europa die langanhaltendste friedliche Periode seit Menschengedenken erlebt. Wie fragil das Ganze jedoch ist, das zeigen die Ereignisse an der Peripherie, der Bosnienkrieg, die Auseinandersetzungen in der Ukraine. Und außerhalb des europäischen Kontinents bleibt Frieden immer noch eine ferne Utopie. Es gibt in diesen Tagen auf der Welt so viele Kriege und regionale Konflikte wie lange nicht. Wer jedoch beispielsweise die Auseinandersetzungen in Afrika rein als innerkontinentales Konfliktthema verortet, sollte sich daran erinnern: Viele dieser Auseinandersetzungen, die uns hier wenig (be-)kümmern, sind (auch) späte Früchte europäischer Kolonial- und Eroberungspolitik, Früchte des Zorns, ein Erbe vor allem des 20. Jahrhunderts.
Auf der Insel der europäisch Friedlich-Seligen schadet der Blick zurück freilich niemals: Die Hoffnung, dass aus dem Vergangenen gelernt wird, stirbt zuletzt. Und da ist das 20. Jahrhundert eines, das zweifelsohne und über die beiden Katastrophen der zwei Weltkriege hinaus, Konflikt- und Verarbeitungsstoff ohne Ende bietet. Zumal die Jubelfeiern übertünchen, dass längst nicht alles schwarz-rot-gold ist, was da glänzt. Aus der Geschichte lernen – was wurde gelernt?
Friedensnobelpreisträger Gorbatschow äußerte sich dieser Tage enttäuscht, spricht von einem Zusammenbruch des Vertrauens, einem Neubeginn des Kalten Krieges. Welche Verantwortung übernimmt dabei das Land der Dichter&Denker in der Welt – das Land, das trotz Aufklärung und Sturm&Drang im 20. Jahrhundert zweimal zurück in die tiefste Barbarei steuerte?
Einschub: Ein lesenswerter Beitrag dazu auf form7:
http://form7.wordpress.com/2014/11/09/gorbatschow-zitiert-willy-brandt/
Und welche Rolle übernehmen die Dichter&Denker? Ist die Kunst, frei nach Schiller, eine Tochter der Freiheit? Sind Kunst und Politik verwandt, verbunden oder getrennte Wesen? Kann man dann, wo die Worte unzureichend erscheinen, Gedichte machen? Oder muss man gerade darum ringen, das Unfassbare in Worte zu fassen?
Hierzu Schiller, „Über die ästhetische Erziehung des Menschen“:
„Aber sollte ich von der Freiheit, die mir von Ihnen verstattet wird, nicht vielleicht einen besseren Gebrauch machen können, als Ihre Aufmerksamkeit auf dem Schauplatz der schönen Kunst zu beschäftigen? Ist es nicht wenigstens außer der Zeit, sich nach einem Gesetzbuch für die ästhetische Welt umzusehen, da die Angelegenheiten der moralischen ein so viel näheres Interesse darbieten und der philosophische Untersuchungsgeist durch die Zeitumstände so nachdrücklich aufgefordert wird, sich mit vollkommensten aller Kunstwerke, mit dem Bau einer wahren politischen Freiheit zu beschäftigen?
Ich möchte nicht gern in einem andern Jahrhundert leben und für ein andres gearbeitet haben. Man ist ebenso gut Zeitbürger, als man Staatsbürger ist; und wenn es unschicklich, ja unerlaubt gefunden wird, sich von den Sitten und Gewohnheiten des Zirkels, in dem man lebt, auszuschließen, warum sollte es weniger Pflicht sein, in der Wahl seines Wirkens dem Bedürfnis und dem Geschmack des Jahrhunderts eine Stimme einzuräumen?“
Was also haben die Dichter zum gewalttätigen zurückliegenden Jahrhundert zu sagen?
Eine lange Vorrede zu einem besonderen Buch: In „Niemals eine Atempause“ stellte Joachim Sartorius als Herausgeber ein „Handbuch der politischen Poesie im 20. Jahrhundert“ zusammen. Dieser lyrische Atlas, in dem sich Gewalttätigkeiten, Katastrophen und Morde ebenso wie der Wille zum Aufbruch, zur Veränderung, der Wunsch nach anderen Verhältnissen niederschlagen, lässt die Stimmen von mehr als 100 Poetinnen und Poeten erklingen: Von Wort- und Schriftführern ihrer Ideologie, Mitläufern und willfährigen Hofdichtern bis hin zur „Schreckenskammer“ der dichtenden Diktatoren und Despoten einerseits, von Widerständlern, Mahnern, Moralisten und Kritikern der Macht andererseits. Erfreulicherweise ist das Buch nicht eurozentrisch, greift ebenso Konflikte auf, die das 20. Jahrhundert auch in anderen Teilen der Welt prägten: Die lateinamerikanische Befreiungsbewegung, der Kampf gegen die Apartheid, die Kriege in Asien, Vietnam und chinesische Kulturrevolution bis hin zum Nahen Osten. Großen Raum nehmen aber selbstverständlich die beiden Weltkriege, Holocaust und Todeslager, Kalter Krieg und Wiedervereinigung (siehe dazu der vorhergehende Beitrag) ein. Jedem Kapitel ist eine Einführung zu Politik und Geschichte vorangestellt, zudem werden etliche Gedichte, vor allem die derjenigen Dichter mit hermetischerer Ausdrucksweise, kurz erläutert und interpretiert.
Das Buch ist chronologisch angeordnet und beginnt mit dem Genozid an den Armeniern (1909-1918) und endet nach einem Kapitel über „Die grüne Utopie“, die das Ende des 20. Jahrhunderts prägte, mit einem Epilog durch Bob Dylan: „Masters of War“. Die „Schreckenskammer“ mit „Gedichten der Despoten“, darunter Stalin, Mussolini, Mao Tse-Tung, ist dem Ganzen abseits als Anhang beigestellt.
Soviel zum Formalen. Zum Inhaltlichen: Geschichtsschreibung ist niemals objektiv. Lyrik sowieso überhaupt nie. Und jede Auswahl wird von einem Subjekt getroffen. So ist dieses Handbuch der politischen Poesie eben auch eng mit der Person des Herausgebers verknüpft, ein Abbild seiner Entscheidungen. Sartorius („Jurist, Diplomat, Theaterintendant, Lyriker und Übersetzer“ in der bei „Wikipedia“ aufgeführten Reihenfolge), scheint dafür die richtige Wahl: Einer, der sich in der Lyrik auskennt wie in seinem eigenen Zuhause, gebildet, kosmopolitisch geprägt, ein Humanist, ja, durchaus ein Poesie-Diplomat, dem man ausgewogene Entscheidung zutraut, auf dessen Auswahl man sich also auch bei diesem Handbuch stützen mag. In seinem Vorwort umreißt Sartorius kurz das Verhältnis von „Poesie und Macht“:
„Es scheint im Rückblick, gerade dieses Jahrhundert war so beschaffen, dass die Intellektuellen, die Künstler, die Schriftsteller Partei ergreifen mussten. Und die Dichter? Sie bewegen sich in einem besonderen Spannungsfeld. Per definitionem ist der Dichter ein Einsamer, auf dem Rückzug, in Betrachtung versunken. Wenn er die Probleme der Epoche nicht aufgreift, scheint sein Werk ohne Nutzen, wie disqualifiziert.“
Sartorius Anliegen war es, unter dem Meer politischer Gedichte – und letztendlich wäre ja jedes Gedicht als Ausdruck einer menschlichen Befindlichkeit per se politisch – jene beiseite zu lassen, die „dem Zeitgeist verpflichtet, ohne Dauer“ sind. Er begrenzt die Auswahl auf jene, die „politisch“ in dem Sinne sind, dass sie ein politisches (geschichtliches) Thema aufgreifen beziehungsweise eine politische Absicht verfolgen. Schwieriger schon die Entscheidung, was ein „gutes politisches“ Gedicht nun sei:
„Fast immer überschneiden sich Ethik und Ästhetik in einem politischen Gedicht.“
Sartorius weiter:
„Im 20. Jahrhundert wurde aber „angesichts des Schreckens, der sich darin abspielte, bald deutlich“, so Matthias Göritz, „dass diese Haltung so nicht mehr einzunehmen ist. Wörter sind nicht unschuldig, gerade die Dichter wissen das.“ So wurde eine Richtung immer stärker, die sich sowohl vom hermetischen Text wie vom lyrischen Subjektivismus abgrenzte und versuchte, Fakten sprechen zu lassen, also zu erzählen und zu argumentieren, ohne den dem Gedicht spezifischen Empfindungsgeist und seine Erregungskunst hinter sich zu lassen. In diesem Rahmen gibt es Gedichte mit guter Botschaft und von zweifelhafter Machart, und es gibt gute Gedichte mit zweifelhafter Botschaft. Das Urteil, ob es sich um ein Kunstwerk handelt, muss ästhetisch gefällt werden und ist letztlich ganz subjektiv. Ich habe versucht, Gedichte aufzunehmen, die sich politische Themen vornehmen, keine einfache Moral haben und imstande sind, Komplexität des Nachdenkens und der Gefühle zu erzeugen.“
Unter dieser Maßgabe ist diese subjektive Auswahl für das Handbuch – Herausgeber und Verlag weisen darauf hin, dass es die erste Gedicht-Anthologie zur politischen Poesie des 20. Jahrhunderts sei – durchaus gelungen. Doch weit mehr als das Anliegen, sich mittels eines Handbuches einen ersten Überblick zu verschaffen, zählt dieser Gedanke:
„Leiden duldet kein Vergessen“
Denn letztlich rufen diese Gedichte, die auch von persönlichem Leid, Verlusten, aber auch Versagen und Ängsten angesichts menschlicher Gewalt erzählen, vor allem in Erinnerung, wie dünn das zivilisatorische Eis bleibt, auf dem wir in scheinbar friedlichen Zeiten dahingleiten. Dass es nach barbarischen Zeiten auch weiterhin Gedichte geben muss, um der Barbarei, wenn möglich, vorzubeugen. Sartorius endet sein Vorwort damit:
„Dieses Handbuch soll zeigen: Es gibt keine Aneignung der Geschichte durch Gedichte. Aber Gedichte kommentieren die Zeitläufte, sie zeigen Entsetzen, sie klagen an oder sie rufen auf, sie können „eine Schule für Güte, Sühne, Reue und Vergebung sein“ (Zbigniew Herbert in seiner Dankesrede für den Preis der Europäischen Poesie, 1997). Vor allem zeigen sie das Vertrauen ihrer Schöpfer, dass die Worte langfristig auf das Bewusstsein wirken und am Ende Wirklichkeit stärker modellieren als Geschichtsbücher oder politische Entscheidungen.“
Nicht aufgenommen in das Handbuch hat der Herausgeber übrigens eines seiner eigenen Gedichte, dessen Titel lautet: „Im Vernichtungsbuch“. Es beginnt mit diesen Zeilen:
Daß die Bäcker ihre weißen Hände ausziehen.
Daß die Metzger vor den Tieren sterben.
Daß die Dichter einen nutzlosen Mund haben,
den sie rund machen und breit ziehen.
Das steht im Vernichtungsbuch geschrieben.
Wer dagegen zu Wort kommt, dazu in kommender Zeit noch mehr.
Einen ersten Blick ins Buch ermöglicht die Verlagsseite (siehe Leseprobe): http://www.kiwi-verlag.de/buch/niemals-eine-atempause/978-3-462-04691-5/
Auch Wolfgang Schiffer stellt die Anthologie auf seinem Blog “Wortspiele” vor:
http://wolfgangschiffer.wordpress.com/2014/11/18/niemals-eine-atempause/