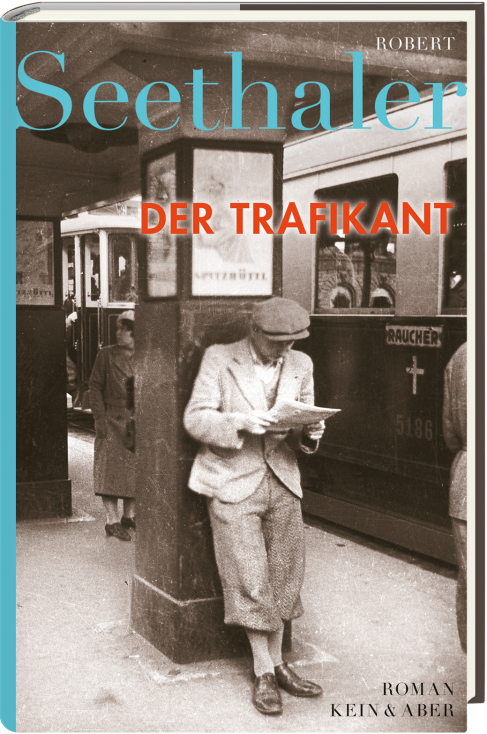„Mir gefiel dieses Hotel nicht mehr: die Waschküche nicht, an der die Menschen erstickten, der grausam wohlwollende Liftknabe nicht, die drei Stockwerke Gefangener. Wie die Welt war dieses Hotel Savoy, mächtigen Glanz strahlte es nach außen, Pracht sprühte aus sieben Stockwerken, aber Armut wohnte drinnen in Gottesnähe, was oben stand, lag unten, begraben in luftigen Gräbern, und die Gräber schichteten sich auf den behaglichen Zimmern der Satten, die unten saßen, in Ruhe und Wohligkeit, unbeschwert von den leichtgezimmerten Särgen.“
Joseph Roth, „Hotel Savoy“, 1924
Das Hotel als Mikrokosmos, in dem eine ganze Welt sich einfindet: Dies ist als Motiv in der Literatur nicht unbekannt. In diesem schmalen Frühwerk von Joseph Roth wird das Hotel jedoch sogar zum Sinnbild einer ganzen Epoche – als Schauplatz des Auseinanderklaffens der Klassen, als Ort der Verlorenheit der Kriegsheimkehrer, als Ausgangspunkt einer Revolution.
Das Hotel Savoy, gleichsam das Europa der Zwischenkriegszeit. Ein Ort, der alles ermöglicht:
„Mit einem Hemd konnte man im Hotel Savoy anlangen und es verlassen als Gebieter von zwanzig Koffern.“ Oder als toter Mann: „Viele Heimkehrer hat der Tod im Hotel Savoy erreicht. Er hatte ihnen sechs Jahre lang nachgestellt, im Krieg und in der Gefangenschaft – wem der Tod nachstellt, den trifft er auch.“
Die Handlung dieses Romans ist schnell erzählt. Roth hat das Geschehen im polnischen Lodz angesiedelt, man schreibt das Jahr 1919. Der Kriegsheimkehrer Dan sehnt sich nach einem Ort der Ruhe:
„Zum ersten Mal nach fünf Jahren stehe ich wieder an den Toren Europas. Europäischer als alle anderen Gasthöfe des Ostens erscheint mir das Hotel Savoy mit seinen sieben Etagen, seinem goldenen Wappen und einem livrierten Portier. Es verspricht Wasser, Seife, englisches Klosett, Lift, Stubenmädchen in weißen Hauben, freundlich blinkende Nachtgeschirre wie köstliche Überraschungen in braungetäfelten Kästchen; elektrische Lampen, aus rosa und grünen Schirmen erblühend wie aus Kelchen; schrillende Klingeln, die einem Daumendruck gehorchen; und Betten, daunengepolsterte, schwellend und freudig bereit, den Körper aufzunehmen.“
Solcher Luxus bleibt dem ehemaligen Soldaten, der einst davon träumte, Schriftsteller zu werden, jedoch versagt. Er kommt dort im Savoy unter – jedoch dort, wo die Armen hausen, dahinvegetieren, sterben: In den oberen Stockwerken. Oben sie – unten die: Die Reichen, die Industriellen, die Kapitalisten, die in der Bar Schampus süffeln und nackte Mädchen tanzen lassen.
„Das Hotel Savoy“, sagt Zwonimir zu den Heimkehrern, „Ist ein reicher Palast und ein Gefängnis. Unten wohnen in schönen, weiten Zimmern die Reichen, die Freunde Neuners, des Fabrikanten, und oben die armen Hunde, die ihre Zimmer nicht bezahlen können und Ignatz die Koffer verpfänden. Den Besitzer des Hotels, er ist ein Grieche, kennt niemand, auch wir beide nicht, und wir sind doch gescheite Kerle. Wir haben alle schon lange Jahre nicht in so schönen, weichen Betten gelegen wie die Herrschaften im Parterre des Hotel Savoy. Wir haben alle schon lange nicht so schöne, nackte Mädchen gesehn wie die Herren unten in der Bar des Hotels Savoy.“
Die Hoffnungen der Arbeiter, der Kriegsversehrten, der verarmten jüdischen Bevölkerung richten sich vor allem auf die Ankunft eines der ihren, der in den USA sein Glück machte: Henry Bloomfield. Dan, aus dessen Perspektive das Geschehen erzählt wird, wird dessen Sekretär – ein Mittler zwischen den Welten, der ebenso voller Mitgefühl von dem Los der Entwurzelten und Verarmten zu erzählen vermag wie von der Befindlichkeit eines Bloomfields, der in der Heimatstadt zu einer Art „Heilsbringer“ erkoren wird. Eine Rolle, vor der dieser letztlich flüchtet. Nach dessen Abreise entlädt sich der Zorn, die Gewalt: Im „Hotel Savoy“ bricht eine Revolution aus, das Gebäude liegt am Ende in Trümmern. Und Dan reist ab – ohne Perspektive, ohne konkretes Ziel.
Der Roman erschien zunächst 1924 in der Frankfurter Zeitung als Fortsetzung und löste ein großes Echo aus: So präzise, so ironisch hatte Roth in diesem Buch den Untergang einer Epoche beschrieben, so sehr traf er mit diesem Werk, das auch als Fabel gelten könnte, den Geist seiner Zeit. Es ist die Zeit der Entwurzelung, der Verunsicherung, der Heimatlosigkeit. Die Wunden des ersten Krieges bluten noch und werden zur nächsten Katastrophe führen.
Hellsichtig schreibt Roth:
„Es sah aus, als wollte ein neuer Krieg ausbrechen. So wiederholt sich alles: Der Rauch steigt wieder aus den Schornsteinen der Baracken, Kartoffelschalen liegen vor den Türen, Fruchtkerne und faule Kirschen – und Wäsche flattert auf ausgespannten Schnüren. Es wurde unheimlich in der Stadt.“
Insbesondere die Schicksale und Empfindungen der Kriegsheimkehrer schildert Roth eindringlich und eindrucksvoll – er selbst war zunächst zwar als kriegsuntauglich eingestuft worden und vertrat zudem eine pazifistische Haltung, meldete sich jedoch zum Militärdienst 1916 auch aus Gewissensbissen heraus – zu viele andere Weggenossen aus dem Literaturstudium in Wien hatten sich schon zuvor zur Front gemeldet.
„Es ist wieder die Zeit der Heimkehrer. (…) Der Staub zerwanderter Jahre liegt auf ihren Stiefeln, auf ihren Gesichtern. Ihre Kleider sind zerfetzt, ihre Stöcke plump und abgegriffen. Sie kommen immer denselben Weg, sie fahren nicht mit der Eisenbahn, sie wandern. Jahrelang mögen sie so gewandert sein, ehe sie hier ankamen. Sie wissen von fremden Ländern und fremden Leben und haben, wie ich, viele Leben abgestreift.“
Mit starken Bildern, präziser Sprache, melancholisch, aber unsentimental entwirft Roth auf den wenigen Seiten dieses Romans ein ganzes Bild seiner Epoche, ein Weltbild. Dies macht das Werk unbedingt empfehlenswert.
„Die Heimkehrer sind meine Brüder, sie sind hungrig. Nie sind sie meine Brüder gewesen. Im Felde nicht, wenn wir, von einem unverstandenen Willen getrieben, fremde Männer totmachten, und in der Etappe nicht, wenn wir alle, nach dem Befehl eines bösen Menschen, gleichmäßig Beine und Arme streckten.“
Die Kriegserfahrungen wurden für den 1894 in Ostgalizien geborenen Joseph Roth zu einem einschneidenden Erlebnis. Dies und der Untergang der alten Zeit, der Zerfall Österreich-Ungarns wurden Themen, die der Schriftsteller und Journalist immer wieder aufgriff. Roth erlangte schließlich mit den Romanen HiobundRadetzkymarsch hohe Bekanntheit. 1933 musste der jüdische Schriftsteller nach Frankreich emigrieren, er starb, verarmt und an den Folgen seiner jahrelangen Alkoholerkrankung leidend, in Paris am 27. Mai 1939.
„Hotel Savoy“ gibt es als gebundene Sonderausgabe bei Kiepenheuer & Witsch, ISBN: 978-3-462-03669-5, 128 Seiten, 10,00 Euro
und als dtv-Taschenbuch, ISBN: 978-3-423-13060-8, 128 Seiten, 7,90 Euro.
Weitere Romane aus der Zeit zwischen den beiden Weltkriegen:
Alfred Döblin, “Berlin Alexanderplatz”
Georg Fink, “Mich hungert”
Erich Maria Remarque: “Im Westen nichts Neues”
Gefällt mir:
Gefällt mir Lade...