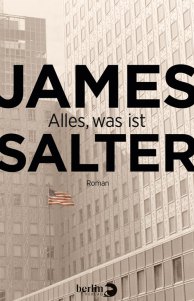Vor etwa 25 Jahren wurde ich einmal von einer Muse geküßt. Am nächsten Morgen schrieb ich den ersten Satz meines immer noch unvollendeten Romans. Offenbar war jedoch ein Kuss nicht genug - bei dem einen Satz sollte es fortan bleiben. Wie das so ist mit den Musenküssen. Ob Schreiben-Können auch mit dem Viel-Schreiben kommt, was Übung ist, was Routine, wieviel Talent wiegt und wieviel Zu- und Selbstvertrauen, Handwerk und Übung ausmachen - darüber macht sich die Schriftstellerin Jutta Reichelt auf ihrem Blog “Über das Schreiben von Geschichten” viele Gedanken. Man kann dabei mitlesen, davon lernen und zwischendurch sogar mitspielen - beispielsweise, wenn Christoph einfach verschwindet.
Vor etwa 25 Jahren wurde ich einmal von einer Muse geküßt. Am nächsten Morgen schrieb ich den ersten Satz meines immer noch unvollendeten Romans. Offenbar war jedoch ein Kuss nicht genug - bei dem einen Satz sollte es fortan bleiben. Wie das so ist mit den Musenküssen. Ob Schreiben-Können auch mit dem Viel-Schreiben kommt, was Übung ist, was Routine, wieviel Talent wiegt und wieviel Zu- und Selbstvertrauen, Handwerk und Übung ausmachen - darüber macht sich die Schriftstellerin Jutta Reichelt auf ihrem Blog “Über das Schreiben von Geschichten” viele Gedanken. Man kann dabei mitlesen, davon lernen und zwischendurch sogar mitspielen - beispielsweise, wenn Christoph einfach verschwindet.
Und das führt zu ihrer “verschämten Lektüre”: Denn selbst Schriftstellerinnen träumen anfangs noch ein wenig vom “Musenkuss”, wenn er in Form eines verkappten Sachbuches daherkommt…
Jutta Reichelt bringt so einen ganz neuen Aspekt in die #VerschämteLektüren. Und wie das so ist mit den verdammt guten Romanen, das kann man dann im Frühjahr 2015 sehen: Da erscheint ihr neuer Roman beim Verlag Klöpfer & Meyer, den ich wegen seines ambitionierten Programms und seiner schön gemachten Bücher sehr schätze. Zur Verlagsvorschau mit Einblick in “Wiederholte Verdächtigungen” geht es hier: http://www.book2look.com/book/HdJvCpFdt2
Jetzt aber Jutta und der Roman vom Musenkuss:
“Ich habe mich entschlossen (nach mehreren schlaflosen Nächten), diese Möglichkeit der #VerschämteLektüren für eine Offenbarung zu nutzen, die geeignet ist, meinen halbwegs guten Ruf als literarische Autorin zu ruinieren.
Ich muss dazu etwas ausholen: Als ich zu schreiben begann, wusste ich nicht, wie ich was schreiben wollte, aber ich wusste, dass die Autorinnen und Autoren, die ich schätzte und die meinen inneren Referenzrahmen bestimmten (hätte ich damals nicht so sagen können) „literarische“ Autoren waren.
Ich wusste nicht, wie und was sich schreibend lernen lässt und ob es dafür Regeln gibt. Ich wusste auch nicht, warum die Texte, die ich schrieb, mir nicht gefielen. Jedenfalls nicht so richtig. Ich versuchte, genauer darauf zu achten, wie „andere“ schrieben – und vergaß diese Frage aber über der Lektüre immer wieder sofort.
Trotzdem schrieb ich weiter. Ich hatte das Gefühl, das sich etwas an meinem Schreiben in die richtige Richtung entwickelte, ohne dass ich hätte sagen können, was es war. Ab und zu gab ich, was ich schrieb, meinem Bruder, der mir mit großer Geduld erzählte, was er in meinen Texten las – und wie sie vielleicht gewinnen könnten. Nannte auch AutorInnen, die mir vielleicht gefallen könnten. So ging viel Zeit dahin.
Schön wäre es gewesen, wenn es einfacher gewesen wäre. Und dann las ich diesen Titel (Trommelwirbel!): „Wie man einen verdammt guten Roman schreibt“ von James N. Frey!
Ich habe das Buch gelesen. Ich habe es sogar verschlungen. Es ist lange her, aber es war so! Ich habe für zwei bis vier Monate gedacht, ich wäre gerettet. Meine Texte wären gerettet. Ich habe gedacht, dass alles viel einfacher ist, als ich je für möglich gehalten hätte. Eine Prämisse! Alles, was mir fehlte, war eine Prämisse! Und: „Konflikt! Konflikt! Konflikt!“
Leider ist es dann alles doch komplizierter und einfacher zugleich und mittlerweile weiß ich, dass Schreibratgeber wie Medizin sind: Sie können wirkungslos sein, hilfreich – oder schädlich. Wir wissen meist, wie ein Text sein sollte, wir wissen nicht, was mit unserem Text nicht stimmt. Wir halten unsere Texte ja für spannend oder komisch oder unglaublich berührend und irren uns nicht über „die Regeln“, sondern über unseren konkreten Text. Das ist das Problem …
Mittlerweile weiß ich auch, dass „Schreibratgeber“ und noch dazu solche mit einem derart marktschreierischen Titel für manche Autorinnen „eigentlich“ in die zweite Reihe gehören – und weil ich immer noch viel zu viele Bücher besitze, sind sie da auch gelandet. In ehrenwerter Gesellschaft …”
Hier geht es zum Blog der Autorin: http://juttareichelt.com/
Und auch beim Literaturhaus Bremen kann man sie finden: http://www.literaturhaus-bremen.de/autor/jutta-reichelt
Dies ist jetzt der vorläfufig letzte Beitrag zu den #VerschämtenLektüren, den ich auf Vorrat habe. Offenbar befinden sich etliche noch ein wenig im Winterschlaf…Allen Leserinnen und Lesern, Bloggerinnen und Bloggern der Hinweis: Wer Lust hat, über die Lieblingsbücher zu plaudern, die man jedoch im Literaturzirkel nicht unbedingt vorschlägt - hier gibt es die Möglichkeit dazu. Wie man mitmachen kann, steht unter anderen in den Spielregeln: http://saetzeundschaetze.com/2014/11/21/verschamte-lekturen-spiel-und-spasregeln/